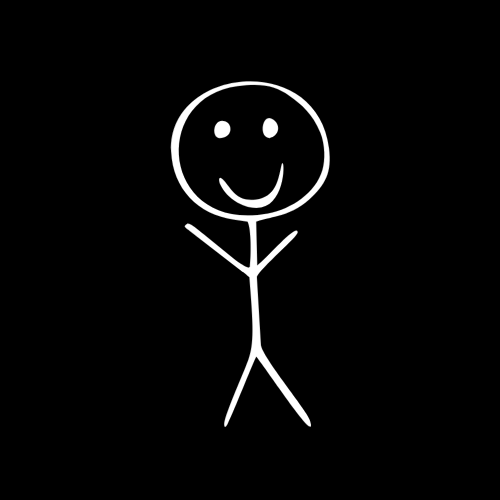Eskalation in Neukölln: Antisemitismus in Berliner Bar schockiert Gäste
Eskalation in Neukölln: Antisemitischer Vorfall in Bar sorgt für Kontroversen und wirft Fragen zu Antisemitismus und Israel auf.

Eskalation in Neukölln: Antisemitismus in Berliner Bar schockiert Gäste
In der Berliner Neuköllner Bar „K-Fetisch“ kam es zu einem erschütternden Vorfall, der die Debatte um Antisemitismus in Deutschland neu entfacht. Ein Paar, bestehend aus der Berlinerin Raffaela B. und ihrem israelischen Freund Abby A., wurde von einer Barkeeperin der Bar verwiesen, nachdem Raffaela ein T-Shirt mit hebräischen und arabischen Schriftzeichen trug, auf dem das Wort „Falafel“ abgebildet war. Die Barkeeperin äußerte, dass sie keine „Zionisten“ bediene und beschimpfte das Paar, während sie ihnen vorwarf, einen Völkermord zu unterstützen. Abby, der seit zwölf Jahren in Berlin lebt, beschreibt die Situation als zutiefst antisemitisch und unhaltbar, insbesondere in einem Lokal, das ursprünglich von einem israelsolidarischen Kollektiv gegründet wurde WELT.
Der Vorfall wirft Fragen zur ideologischen Ausrichtung der Bar auf. Seit ihrer Eröffnung im Jahr 2012 wurden in „K-Fetisch“ häufig Veranstaltungen über Antisemitismus und Islamismus organisiert. Ab 2018 kam es jedoch zu innerlinken Konflikten über die Haltung zu Israel. Die Rückkehr zu einer antiimperialistischen und antizionistischen Ausrichtung im Jahr 2020, insbesondere nach dem Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023, verstärkte die Spannungen. In den folgenden Wochen fanden mehrere israelfeindliche Veranstaltungen statt, und die Bar wurde mit antisemitischen Schmierereien beschmiert. Obwohl das Kollektiv eine Erklärung zur Verurteilung antisemitischer Gewalt abgab, wurden proisraelische Gäste kritisiert, was für Ehemalige Anlass zu einem offenen Brief gab, um ihre Bedenken zu äußern. Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) bezeichnete den Vorfall als unerträglich und als Antisemitismus in Reinform WELT.
Antisemitismus im Kontext der politischen Debatten
Der Vorfall in Neukölln ist Teil eines größeren Trends, der in Deutschland nach dem Hamas-Massaker von 2023 beobachtet wird. Laut dem Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus (RIAS) ist die Zahl antisemitischer Vorfälle seitdem stark gestiegen. Im Zeitraum zwischen dem Terrorangriff und Ende 2024 wurden 2.225 antisemitische Versammlungen registriert, was im Vergleich zu nur 1.636 Vorfällen im Zeitraum davor einen alarmierenden Anstieg darstellt. In 89 Prozent dieser Versammlungen wurde israelbezogener Antisemitismus dokumentiert, was deutlich macht, wie stark die politische Auseinandersetzung um den Nahostkonflikt auch in Deutschland Einfluss auf die Gesellschaft hat Tagesschau.
Die Debatte über Antisemitismus wird auch durch die unterschiedliche Definition des Begriffs und dessen politische Implikationen weiter kompliziert. Die IHRA-Definition und die Jerusalemer Erklärung (JDA) führen oft zu Kontroversen. Während die IHRA-Definition bestimmt, dass bestimmte Aussagen über Israel antisemitisch sein können, versucht die JDA, Antizionismus vom Verdacht des Antisemitismus freizusprechen. Diese Unterscheidungen sind entscheidend, da sie die Bekämpfung von Antisemitismus in der politischen Diskussion und im öffentlichen Raum beeinflussen, insbesondere in einem Klima, in dem emotionale und historische Erben des Konflikts zwischen Israel und Palästina stark umstritten sind. Immer wieder müssen dabei politische Akteure und Gesellschaft überlegen, wie sie mit den Äußerungen zum Nahostkonflikt umgehen, ohne in die Falle des Antisemitismus zu tappen. Diese verworrene Dynamik zeigt sich auch in den antisemitischen Vorfällen und den dazugehörigen Diskursen in Deutschland bpb.

 Suche
Suche
 Mein Konto
Mein Konto